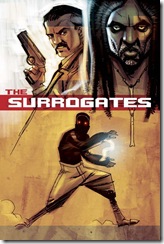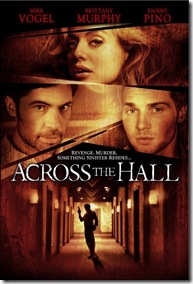Originaltitel: Sherlock Holmes
Herstellungsland: USA 2009
Regie: Guy Ritchie
Drehbuch: Michael Robert Johnson, Anthony Peckham, Simon Kinberg
Darsteller: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, James Fox, Kelly Reilly
Dass ein Film gewisse Schwierigkeiten hat, ist oft daran zu erkennen, dass mehrere Autoren für das Drehbuch verantwortlich zeichnen. Im Falle von „Sherlock Holmes“ waren es drei, plus zwei weitere für die Entwicklung der Story. Dazu kommt noch, dass Regisseur Guy Ritchie zuletzt mit „Stürmische Liebe –Swept Away“, „Revolver“ und „RocknRolla“ drei Flops in Serie zu verantworten hatte und ein Neuling in Sachen Big-Budget-Film ist (ihm standen angeblich $80 Millionen zur Verfügung) – und diesem Druck musste er offensichtlich Tribut zollen.
Das dürfte auch der Grund sein, warum „Sherlock Holmes“ letztendlich nur ein Hochglanz-Actionfilm wurde, wie ihn wohl jeder x-beliebige Regisseur hätte drehen können. Hie und da sind Reste des typischen Ritchie –Stils auszumachen, etwa der wirkungsvolle Einsatz der Zeitlupe in den Kampfszenen, aber alles in allem haben wir es mit einer durch und durch amerikanischen Großproduktion zu tun.
Die gute Nachricht für alle Holmes-Puristen, denen allein schon bei der Vorstellung übel wird, dass der gewiefteste Detektiv der Literaturgeschichte zur Witzfigur verkommen könnte, ist zugleich eine schlechte Nachricht für alle anderen: „Sherlock Holmes“ ist nicht einmal ein großartiger Missgriff. Es ist nur ein Film, der in einem die Sehnsucht nach den früheren Werken von Mr. Ritchie weckt. Sogar nach „Snatch“.
 Der Titelheld wird mit viel Übertreibung von Robert Downey Jr. gespielt, während Jude Law seinen ständigen Begleiter Dr. Watson gibt - letzterer wurde sicher allein aufgrund seines Aussehens und seiner Ausstrahlung besetzt, denn seine seltsam langweilige Aura scheint wie geschaffen für die Rolle. Aber die beiden vermögen nicht zu überzeugen: Downey Jr. spielt Holmes als Cartoon-Figur mit unstetem Blick anstatt als genialen Denker, Laws Watson ist ein wandelndes Nichts.
Der Titelheld wird mit viel Übertreibung von Robert Downey Jr. gespielt, während Jude Law seinen ständigen Begleiter Dr. Watson gibt - letzterer wurde sicher allein aufgrund seines Aussehens und seiner Ausstrahlung besetzt, denn seine seltsam langweilige Aura scheint wie geschaffen für die Rolle. Aber die beiden vermögen nicht zu überzeugen: Downey Jr. spielt Holmes als Cartoon-Figur mit unstetem Blick anstatt als genialen Denker, Laws Watson ist ein wandelndes Nichts.
Der Fall, den sie zu lösen haben, ist von internationaler Bedeutung. Während Arthur Conan Doyle seinen Helden mit kleinen, recht überschaubaren Problemen konfrontierte, muss dieser Holmes die ganze Welt retten. Ein stark an Aleister Crowley erinnernder Satanist (Mark Strong, bekannt aus einigen anderen Ritchie-Filmen, mit Bela-Lugosi-Frisur) hat eine Plan ausgeheckt, der dem „Da Vinci Code“ an Größe und Komplexität in nichts nachsteht und solche Kleinigkeiten beinhaltet wie Wiederauferstehung von den Toten, Eindringen ins Parlament und Erlangen der Weltherrschaft. James Bond lässt grüßen.
 Das Ganze ist einfach zu groß aufgezogen, als dass Holmes´ Stärke, sein Spürsinn, sich voll entfalten könnte. Die deduktiven Einsichten bleiben weitgehend auf der Strecke. Die Sachkenntnis dieses Meisterdetektivs würde wohl nicht einmal einen Streifenpolizisten beeindrucken. Die Verkleidungen überraschen kaum, die witzigen Dialoge zünden selten, die Symbolik ist wenig subtil (es gibt da zum Beispiel eine viel zu häufig auftauchende Krähe).
Das Ganze ist einfach zu groß aufgezogen, als dass Holmes´ Stärke, sein Spürsinn, sich voll entfalten könnte. Die deduktiven Einsichten bleiben weitgehend auf der Strecke. Die Sachkenntnis dieses Meisterdetektivs würde wohl nicht einmal einen Streifenpolizisten beeindrucken. Die Verkleidungen überraschen kaum, die witzigen Dialoge zünden selten, die Symbolik ist wenig subtil (es gibt da zum Beispiel eine viel zu häufig auftauchende Krähe).
„Sherlock Holmes“ verwirrt und verblüfft auf die falsche Weise. Ist es eine coole Satire auf viktorianische Ernsthaftigkeit? Ein Thriller? Oder doch eine Komödie? In der Vergangenheit wusste Guy Ritchie zumindest, welche Art Film er drehte, wenn auch das Ergebnis nicht immer überzeugen konnte. Dieser Mischmasch verschiedener Genres deutet darauf hin, dass er das Vertrauen zu seinen Fähigkeiten verloren hat.
Diese Selbstzweifel mögen wohlbegründet sein, aber widerstreitende Intentionen heben einander auf, und so kann Ritchie weder für Authentizität noch für mutige Neuinterpretation Bonuspunkte sammeln.
 Sein einziger Versuch in Richtung Neuinterpretation dürfte die Aufwertung der Holmes/Watson-Beziehung von geselliger Freundschaft (mit homoerotischen Untertönen) zu echter brüderlicher Liebe sein. Und zu Anfang sieht das vielversprechend aus. Mit ihren geschniegelten Anzügen und den schicken Gehstöcken, den Kleinen Wortgefechten und dem gemeinsamen häuslichen Leben erinnern sie an Gilbert und George.
Sein einziger Versuch in Richtung Neuinterpretation dürfte die Aufwertung der Holmes/Watson-Beziehung von geselliger Freundschaft (mit homoerotischen Untertönen) zu echter brüderlicher Liebe sein. Und zu Anfang sieht das vielversprechend aus. Mit ihren geschniegelten Anzügen und den schicken Gehstöcken, den Kleinen Wortgefechten und dem gemeinsamen häuslichen Leben erinnern sie an Gilbert und George.
Aber es ist ein sehr oberflächlicher Versuch der Modernisierung, der rasch langweilig wird. Watsons großes Dilemma – ob er sein Leben mit Holmes hinter sich lassen und die liebreizende Mary (Kelly Reilly, sträflich unterbeschäftigt) heiraten soll – hat den Tiefgang eines Wham-Songs.
 Und obwohl das Drehbuch Rachel McAdams als Irene Adler ins Spiel bringt, eine junge Frau aus Jersey und eine Gegnerin, die Holmes respektvoll als „die“ Frau bezeichnet, wird aus dieser Idee wenig gemacht. Ihre Motive bleiben im Dunkeln selbst wenn sie erklärt werden, die Beziehung zwischen ihr und Holmes hat weder Witz noch Leben.
Und obwohl das Drehbuch Rachel McAdams als Irene Adler ins Spiel bringt, eine junge Frau aus Jersey und eine Gegnerin, die Holmes respektvoll als „die“ Frau bezeichnet, wird aus dieser Idee wenig gemacht. Ihre Motive bleiben im Dunkeln selbst wenn sie erklärt werden, die Beziehung zwischen ihr und Holmes hat weder Witz noch Leben.
Der Film selbst ist aufgebläht, voll von Actionszenen in Zeitlupe (oder, noch langweiliger, Actionszenen, die zweimal gedreht wurden – einmal mit Holmes´ Voraussagen, was er tun wird, und dann noch einmal, wenn er das Gesagte in die Tat umsetzt). Der ganze Film wirkt weniger wie Sherlock Holmes, sondern mehr wie seltsame und unnötige Fortsetzung von „Wild, Wild West“ mit Will Smith.
„Sherlock Holmes“ scheint schon mit Blick auf mögliche Fortsetzungen inszeniert worden zu sein; nicht jeder Bösewicht wird zur Rechenschaft gezogen, und ja, das ist Moriarity selbst, der immer wieder im Schatten lauert. (Im dunkelsten Schatten; anscheinend wartet man, wie dieser Film ankommt, bevor man den Napoleon des Verbrechens besetzt.) Hier jedenfalls ist alles mehr hektisch als unterhaltsam.
Was ist nur schief gegangen, und wie hätte es verhindert werden können? Das ist ein Rätsel, das wohl nur der große Detektiv selbst lösen kann.
Fazit: „Sherlock Holmes“ will zuviel auf einmal sein. Da Ergebnis leidet unter dieser Orientierungslosigkeit. Zwar ist der Detektiv auch in der literarischen Vorlage durch aus ein Athlet, nämlich Boxer, aber hier verkommt er bisweilen zum Action-Kasper. Es sollte ein Familienfilm werden, ein Unterfangen, das mit Abstrichen geglückt ist. Doch zufrieden stellen kann der fertige Streifen wohl nur sehr einfache Gemüter. Möge uns eine Fortsetzung erspart bleiben…